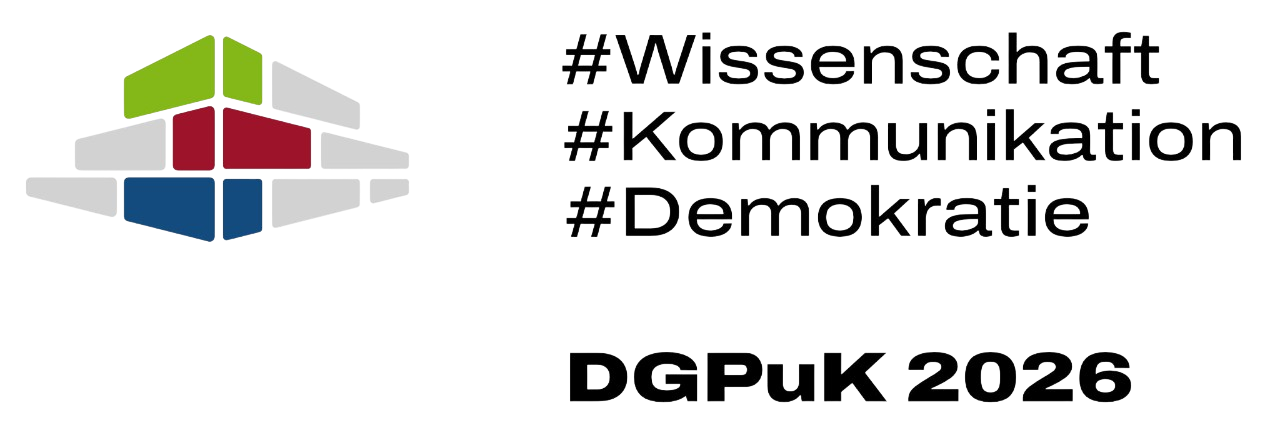Call for Papers der DGPuK-Tagung 2026 vom 18. bis 20. März 2026 in Dortmund
#Wissenschaft #Kommunikation #Demokratie
Journalismus und Wissenschaft gehören zu den unverzichtbaren Eckpfeilern einer demokratischen Gesellschaft. Sie tragen durch fundierte Informationen und kritische Analysen dazu bei, Fakten bereit zu stellen und zu hinterfragen und bieten damit sowohl die Basis für eine informierte Meinungsbildung als auch für den öffentlichen Diskurs. Was aber bedeutet es, wenn sich die Dynamiken der Medienwelt verstärken, sich Kommunikationskonstellationen verändern, neue Spannungsfelder zwischen unterschiedlichsten Kommunikationsakteuren entstehen? Welche Verantwortung kommt einer öffentlichkeitsbezogenen (Kommunikations-)Wissenschaft in einer deliberativen Demokratie zu, deren Informations- und Meinungsbildungsprozesse längst nicht mehr nur digital, sondern zunehmend zusätzlich auch KI-geprägt sein wird?
Im 50sten Jahr seines Bestehens möchte das Institut für Journalistik der TU Dortmund als Ausrichter der DGPuK-Tagung 2026 das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und (journalistischer wie nicht-journalistischer) medienvermittelter Kommunikation vor dem Hintergrund einer weltweit unter Druck stehenden Demokratie in den Fokus stellen. Meinungsfreiheit, Medienfreiheit und Wissenschaftsfreiheit wurden im demokratischen Zusammenleben lange als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Ihre Ausübung wird nun in unterschiedlicher Weise spürbar bedroht. Gängige Finanzierungsmodelle im Journalismus kommen an ihre Grenzen. Eine unabhängige, ihrer öffentlichen Aufgabe gerecht werdenden Berichterstattung ist trotz neuer Geschäftsmodelle oft nur schwer zu gewährleisten. Zusätzlich gilt es sich in der öffentlichen Wahrnehmung abzugrenzen von medialen Quellen und Plattformen, in denen Falschinformationen mehr Profit und Aufmerksamkeit versprechen als auf ihre Qualität hin geprüfte Informationen. Nationale und europäische Rechtsakte und Regulierungskonzepte zur Gewährleistung einer freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung müssen laufend angepasst oder sogar gänzlich neu gedacht werden, um den öffentlichen Diskurs vor Dysfunktionalitäten wie Medienkonzentration, Hassrede, Propaganda und anderen Formen der Desinformation zu schützen, ohne gerade diesen Diskurs selbst einzuschränken. Auch auf Seiten der Rezipient:innen stellt die veränderte Medienwelt neue Herausforderungen im Hinblick auf Nutzungsverhalten, Quellen-, Daten- und Medienkompetenz, damit eine demokratische Urteilsbildung überhaupt noch möglich bleibt. Gleichzeitig steht mit den neuen technischen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens die nächste Revolution nahezu aller Bereiche der Kommunikation bevor.
Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist somit mit einer nie dagewesenen Vielfalt von Kommunikationsmöglichkeiten und -formaten konfrontiert, deren Chancen und Risiken Untersuchungsgegenstand unterschiedlicher Forschungsfelder sind. Mehr noch: Folgt man der Erkenntnis, dass ein funktionierender Informations- und Meinungsbildungsprozess, wie er in früheren Jahrzehnten ganz entscheidend durch den Journalismus geprägt wurde, zentrale Voraussetzung für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften darstellt, erwächst für die damit befassten Wissenschaftszweige eine wachsende Verantwortung, die anstehenden gesellschaftlichen Veränderungen kritisch zu begleiten.
Trotz der großen praktischen Relevanz insbesondere für die politische Meinungsbildung, die (Wissenschafts-)Kommunikation sowie den Journalismus sollen die Tagungsinhalte der DGPuK 2026 keineswegs auf anwendungsnahe empirische Forschungen beschränkt bleiben. Die skizzierten Entwicklungen der Kommunikationsstrukturen, Nutzungsszenarien und Mediensysteme sowie die Interdependenzen zwischen Medien und Demokratie werfen zugleich theoretische und insbesondere auch (medien-)ethische und rechtliche Fragen auf, die auf der Tagung diskutiert werden sollen. Ausdrücklich erwünscht sind dabei auch trans- und interdisziplinäre Forschungsansätze, neue (z. B. KI-assistierte) Methoden sowie intersektionale und international vergleichende Arbeiten. Willkommen sind somit Einreichungen mit Bezug zum Tagungsthema aus allen Bereichen des Fachs. Themen und Anwendungsbeispiele können unter anderem sein:
- Theoretische und empirische Arbeiten zur (auch historischen) Entwicklung der Mediensysteme und Journalismuskulturen sowie zu ihrem Einfluss auf politische und gesellschaftliche Diskurse – insbesondere auch vor dem Hintergrund digitaler und visueller Kommunikation, nicht zuletzt auf digitalen Plattformen
- Untersuchungen von Medienrezeption und -wirkung in unterschiedlichen Zielgruppen sowie zu ihrem Einfluss auf die demokratische Willensbildung, die Wahrnehmung und Einschätzung des öffentlichen Diskurses, die Stärkung von Bürgerbeteiligung und das politische Engagement in der Gesellschaft
- Arbeiten zur Qualität medialer und digitaler Informationen, insbesondere auch zur Erkennung und Kuratierung etwa von Hassrede, Polarisierung, Diskriminierung und Falschinformationen sowie entsprechender Debunking-Strategien
- Überlegungen und Befunde zu Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Vertrauen in der öffentlichen Kommunikation und ihre ethischen Implikationen
- Reflexionen und theoretische Überlegungen zum künftigen Einfluss von KI auf die öffentliche Kommunikation und innovative Methoden ihrer (ebenfalls KI-unterstützten) Erforschung
- Arbeiten und Konzepte zur für die demokratische Willensbildung notwendigen Stärkung von Medien-, Quellen- und Wissenschaftskompetenz („Science & Media Literacy“) von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
- Fragen der Verantwortung von Public Relations, Organisations- und Unternehmenskommunikation bei der Sicherung demokratischer Strukturen
- Vergleichende Forschung zu internationalen Medien- und Journalismussystemen und ihrer jeweiligen Rolle zur demokratischen Willensbildung und Einhaltung von Menschenrechten in unterschiedlichen Ländern und Staatsformen sowie die Abbildungen multi- und transkultureller Zusammenhänge
- Regulierung und Governance individueller und öffentlicher Meinungsbildung unter digitalen Netzwerkbedingungen (v. a. Medien, Plattformen)
- Digitale Redefreiheit: Dysfunktionalitäten und Neujustierungen
- Gesellschaftliche Rückbindung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Sachwalter der Allgemeinheit unter digitalen Netzwerkbedingungen
- Medienökonomische Fragestellungen und Finanzierungsmodelle für den Qualitätsjournalismus im Zuge der Plattformisierung, weitere demokratierelevante Kommunikationsformen sowie für ihre kommunikationswissenschaftliche Erforschung
- Arbeiten zur Rolle und Verantwortung der Kommunikationswissenschaft und ihrer öffentlichen Kommunikation in einer Demokratie, insbesondere auch im Vergleich zur Politikberatung und Wissenschaftskommunikation anderer Disziplinen (z. B. Klimakommunikation, Corona- und sonstige Gesundheitskommunikation, Kommunikation der Friedens- und Konfliktforschung)
Einreichungsmodalitäten
Einreichung und Fristen
Vom 01. Juli 2025 an können Einzelbeiträge und Panels über das Conference Tool eingereicht werden: www.dgpuk2026.de
Die Frist für die Einreichung endet am 1. September 2025.
Die Benachrichtigung über Annahme oder Ablehnung der Einreichungen erfolgt bis zum 16. Dezember 2025.
Alle Einreichungen werden nach den Kriterien theoretische Fundierung, Relevanz der Fragestellung im Hinblick auf das Tagungsthema, Angemessenheit der Methode bzw. theoriegeleiteten Vorgehensweise sowie Klarheit/Prägnanz der Darstellung und Neuigkeitswert/Originalität begutachtet.
Einreichungsformate
Extended Abstracts zum Tagungsthema (Normalverfahren)
Extended Abstracts für Vorträge zum Tagungsthema sollen 4.000 – 6.000 Zeichen umfassen (inkl. Leerzeichen, Literatur, Tabellen und Abbildungen).
Panelvorschläge zum Tagungsthema
Es besteht die Möglichkeit, komplette Panels einzureichen. So können größere Projekte oder Forschungszusammenhänge mit einem Bezug zum Tagungsthema vorgestellt werden. Die einzelnen Vorträge sollen dabei aufeinander bezogen sein. Panelvorschläge müssen enthalten: Paneltitel, Benennung der Moderation/Chair, Beschreibung des Panels in 3.000 – 4.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Literatur, Tabellen und Abbildungen) sowie Titel und Abstract für jeden Vortrag (jeweils 1.000 – 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen, Literatur, Tabellen und Abbildungen). Ein Panel kann bis zu vier Vorträge enthalten. Die gleichzeitige Einreichung einzelner Beiträge aus einem Panelvorschlag im Normalverfahren ist nicht zulässig.
„Kommunikationswissenschaftswissenschaftskommunikation“ – und andere Einreichungen für offene Formate zum Tagungsthema
Das Institut für Journalistik fühlt sich seit jeher der Verbindung von Forschung und kommunikativer Praxis verbunden. Auch auf der DGPuK-Jahrestagung in Dortmund sind daher Einreichungen für andere Formateals die klassischen Vortragssessions besonders willkommen. Dazu zählen insbesondere interaktive Formate, etwa Workshops, Diskussionsrunden (z. B. Fishbowl), Panels mit Personen aus der Medienpraxis, öffentliche Veranstaltungen in der Stadtgesellschaft und andere Ideen. Einreichungen für offene Formate sollen eine inhaltliche Beschreibung des geplanten Formats enthalten sowie dessen geplanten Ablauf kurz skizzieren (ca. 3.000 – 4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen, Literatur, Tabellen und Abbildungen). Die Beiträge sollen nicht-anonymisiert eingereicht werden. Für die offenen Formate wird ein eigenes Review-Verfahren durchgeführt und die Möglichkeit eruiert, diese in das Veranstaltungsprogramm oder ggf. als Pre- oder Post-Conferences einzubauen. Abschließende Entscheidungen über eine Annahme werden vom Organisationsteam auch auf Basis der Passung zum restlichen Programm getroffen. Besonders willkommen sind daher angesichts der im Anschluss an die Tagung stattfindenden 50-Jahr-Feier des Instituts Einreichungen, die die künftige Rolle des Journalismus in der Demokratie thematisieren. Einreichungen werden per E-Mail an dgpuk2026.fk15@tu-dortmund.de erbeten.
Extended Abstracts ohne Bezug zum Tagungsthema (offene Panels)
In offenen Panels finden aktuelle Forschungsarbeiten Platz, die sich nicht unmittelbar in das Tagungsthema einordnen lassen. Abstracts für die offenen Panels sollen ebenfalls etwa 4.000 – 6.000 Zeichen umfassen (inkl. Leerzeichen, Literatur, Tabellen und Abbildungen).
Anforderungen und Hinweise
Einreichungen und Vorträge sind auf Deutsch und Englisch möglich.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Vorschläge keine Hinweise auf die Einreichenden enthalten (Ausnahme: offene Formate).
Eingereicht werden können nur Beiträge, die zum Zeitpunkt der Einreichung (a) noch nicht in schriftlicher Form veröffentlicht wurden und (b) noch nicht bei einer wissenschaftlichen Tagung als Vortrag eingereicht, akzeptiert oder präsentiert wurden, deren Publikum sich mit dem der Jahrestagung maßgeblich überschneidet (dies gilt insbesondere für Fachgruppentagungen). Dass diese beiden Bedingungen erfüllt sind, ist auf dem Deckblatt der Einreichung zu erklären. Auf dem Deckblatt ist auch zu erklären, ob und ggf. in welcher Form KI-basierte Sprachmodelle beim Verfassen der Einreichung hinzugezogen wurden.
Einreichungen sollten auf Basis substanzieller Befunde oder Theoriediskussionen erfolgen. Abstracts, die lediglich eine Vorschau auf erwartete, aber noch nicht vorliegende Befunde enthalten, werden nicht in den Begutachtungsprozess einbezogen.
Das Organisationsteam der Tagung behält sich vor, eingereichte Beiträge in andere Präsentationsformen jenseits des klassischen Vortragsformats einzuladen.
Wir freuen uns auf alle Vorschläge und hoffen, viele von Euch/Ihnen am dann 50 Jahre jungen Institut für Journalistik an der TU Dortmund begrüßen zu können!
Für das Organisationsteam des Instituts für Journalistik an der TU Dortmund:
Prof. Dr. Wiebke Möhring
Prof. Dr. Tobias Gostomzyk
Prof. Holger Wormer
Marcus Kreutler (Institutsmanager)
Kontakt: dgpuk2026.fk15@tu-dortmund.de